Newsletter März 2021
Unsere Themen des Newsletters:
1. „Vereine sind die Schule der Demokratie“ (Interview)
2. Anerkennung für‘s Ehrenamt – Ehrensache!
3. Wir müssen uns bewegen – Sport- und Bewegungsräume der Zukunft
4. Klinisch sauber: Konzept zur Reinigung und Sanitation Sporthallen
5. Was wir voneinander lernen können – KGSt-Betriebsdatenabfrage
6. „Wir müssen digitaler werden …“ - Weiterbildungsprogramm der Führungsakademie
7. Wir stellen vor: das Amt für Bildung und Sport der Stadt Konstanz
1. „Vereine sind die Schule der Demokratie“
Wie das Ehrenamt nicht nur die Vereine, sondern die ganze kommunale Gemeinschaft stärkt
Die Bürgerinnen und Bürger „sind als Vorstände und Übungsleiter in den Vereinen tätig, engagieren sich in Vereinen und Verbänden, wirken bei Planungs- und Entscheidungsprozessen mit oder sind politisch aktiv. Das bunte und vielfältige Engagement der Bürgerschaft prägt unsere Stadt und macht sie so lebendig und lebenswert“, heißt es auf der Website der Stadt Konstanz. Dieses Engagement anzuerkennen, ist dem Oberbürgermeister Uli Burchardt seit langem ein Anliegen. 2013 richtete die Stadt die Stelle des Beauftragten für Bürgerbeteiligung und Bürgerschaftliches Engagement ein. Diese Stelle ist im Referat des Oberbürgermeisters angesiedelt. Im Themenfeld Bürgerbeteiligung hat die Abteilung die Aufgabe, das städtische Gesamtkonzept „Bürgerbeteiligung“ zu steuern und die „Leitlinien für Bürgerbeteiligung“ zu betreuen. Weitere wesentliche Aufgaben sind die Beratung und Unterstützung der Fachämter in Fragen der Bürgerbeteiligung, Erstellung der öffentlichen Vorhabenliste und die Pflege sowie Weiterentwicklung der digitalen Plattform für ePartizipation. Im Bereich Bürgerschaftliches Engagement ist sie Planungs- und Entwicklungsstelle zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, organisiert Fortbildungen für Vereine, betreut die Anerkennungskultur, fördert die Organisationsentwicklung in den Vereinen und organisiert das Bürgerbudget. Seit 2013 ist Martin Schröpel der Beauftragte – und mittlerweile der Experte - für Bürgerbeteiligung und Bürgerschaftliches Engagement in Konstanz. Das sind seine Erfahrungen zu …
… den Anfängen seiner Tätigkeit
„Die Anfänge lassen sich mit einem unbeschriebenen Blatt vergleichen. Vielleicht enthielt es noch die Information, dass es in Konstanz etwa 700 Vereine aus den unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen gibt. Dazu hatte der Oberbürgermeister die Maxime ausgegeben, dass bürgerschaftliches Engagement kein Selbstläufer ist. Und die Erkenntnis, dass alle Vereine unabhängig von ihrem „Satzungsauftrag“ wichtig sind, sobald und solange sie sich an den Werten des Grundgesetzes orientieren und damit dem Gemeinwohl nützlich sind.
Daraus leitete sich dann der oben beschriebene Arbeitsauftrag für den „Ehrenamtsbeauftragten“ ab. Mir kam dabei meine sozialpädagogische Ausbildung sicherlich ebenso zugute wie meine über viele Jahre selbst ausgeübten ehrenamtlichen Tätigkeiten – und die Überzeugung, dass unsere Gesellschaft ohne bürgerschaftliches Engagement von vielen nicht funktionieren kann.“
… den Hauptaufgaben seiner Tätigkeit
„Auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten entwickeln sich weiter, und die Anforderungen an die Ehrenamtlichen steigen. Die Schwerpunkte meiner Tätigkeiten müssen sich daran anpassen, so dass der Bereich der Fort- und Weiterbildungsangebote für Vereine, sei es zum Thema Leadership oder Organisationsmanagement, sei es zum Datenschutz oder zum Thema Nachfolgeregelungen im Verein und vieles andere mehr. Die Palette des Beratungsbedarfs ist breit. Zusätzlich ist es unsere Aufgabe, durch Veranstaltungen den Erfahrungs- und Informationsaustausch unter den Vereinen zu organisieren, Projekte zu initiieren und zu begleiten sowie Netzwerke aufzubauen. Und nicht nur wir selbst, sondern auch die Vereine haben einen Nutzen von dem von uns geführten ‚Vereinsregister‘, indem wir die Vereinsdaten sammeln, zusammenführen und pflegen.“
… den Kompetenzen, die ein/e Beauftragte/r mitbringen sollte
„Wo soll ich da anfangen? Die oder der Ehrenamtsbeauftragte sollte am besten über die Qualitäten der viel besprochenen Eier legenden Wollmilchsau verfügen. Aber im Ernst: sie oder er sollte schon gut kommunizieren und Netzwerken können und in der Lage sein, mit vielen Menschen mit oft unterschiedlichen Interessen Prozesse organisieren können. Er oder sie benötigt sicherlich Organisationsgeschick, muss Empathie-fähig sein, sich in andere hineinversetzen können (welche Unterstützung wird gerade benötigt) und er oder sie sollte sich selbst auch zurücknehmen können: Alle schaffen ‚Gemeinsinn‘.“
… der seiner Tätigkeit zugrunde liegenden Philosophie
„Das sind zunächst die Wertschätzung des Ehrenamts allgemein und der Respekt vor den Leistungen aller Ehrenamtlichen zu nennen.
Der Oberbürgermeister lädt als Zeichen der Wertschätzung einmal im Jahr alle Vereinsvorstände nach dem Motto „Engagement braucht Zukunft“ alle Vereinsvorstände zu einem Empfang ein. Da kommen schon einmal 400 Leute zusammen, die sich kennen lernen und austauschen können. Aber vielleicht noch bedeutender: Bei dieser Veranstaltung werden die Leistungen der Vereine sichtbar! Und auch die Anerkennungskultur selbst mit Leben zu füllen und dafür Zeichen zu setzen, erscheint mir unerlässlich.
Für mich im Alltag ist wichtig, viel mehr in sozialen Milieus und weniger nach ‚Herkunft‘ zu denken. Meine Erfahrung ist, dass über das gemeinsame Tun Integration und Identifikation stattfinden. Die Sportvereine sind dafür in der Regel ein gutes Beispiel.“
… der Bedeutung des Ehrenamtes für die Gesellschaft
„Ich wie auch die Kolleginnen und Kollegen in den Sportverwaltungen erleben es tagtäglich: Ohne ehrenamtliches Engagement vor allem in den unzähligen Vereinen kann unsere Gesellschaft nicht bestehen und unser Zusammenleben nicht gelingen. Das wissen wir alle. Aber eines möchte ich hervorheben: Die Vereine sind die Schule der Demokratie. Dabei geht es mir nicht nur um Solidarität, Freiheit und Gleichheit, sondern ich schließe auch die Fähigkeit, Kompromisse zu schließen, Regeln anzuerkennen und Verantwortung zu übernehmen usw. mit ein. Das ist unbezahlbar.“
… dem Nutzen, den auch der Freiwillige aus seinem Engagement zieht
„Immer wieder höre ich von Ehrenamtlichen, dass und welchen persönlichen Gewinn sie aus ihrem Engagement ziehen. Das fängt damit an, dass sie über das Ehrenamt mit interessanten Menschen in Kontakt kommen, die sie sonst nie kennengelernt hätten. Das Ehrenamt führe zu einem Blick über den Tellerrand, der sie nicht nur im Ehrenamt, sondern oft auch persönlich und auch beruflich weiterbringe. Nicht wenige stellen fest, dass sie durch das Ehrenamt selbstbewusster geworden seien, und sie immer wieder das Gefühl hätten, etwas Sinnvolles zu tun. Ja, man kann die Rückmeldungen von den Ehrenamtlichen fast in dem Satz zusammenfassen: ‚Ehrenamt macht froh – und stark!‘“
… zu der nun schon seit fast 20 Jahren bestehenden „Tatenbörse“
„Die Tatenbörse gibt es seit 2002 und wird derzeit ausschließlich als Online-Plattform betrieben. Institutionen können Ihr Angebot selbstständig einstellen, Freiwillige können suchen oder sich als Engagement-Suchende ebenfalls eintragen. Das Matching von Anfrage und Suche erfolgt dann manuell. Bedingt durch Änderungen im Nachfrageverhalten wird derzeit an einem neuen Konzept gearbeitet, das sich an der an den Bedürfnissen der Vereine und der Freiwilligen orientiert. Kernelement sollen mehr digitale Elemente aber auch ‚Engagement-Lotsen‘ sein.“
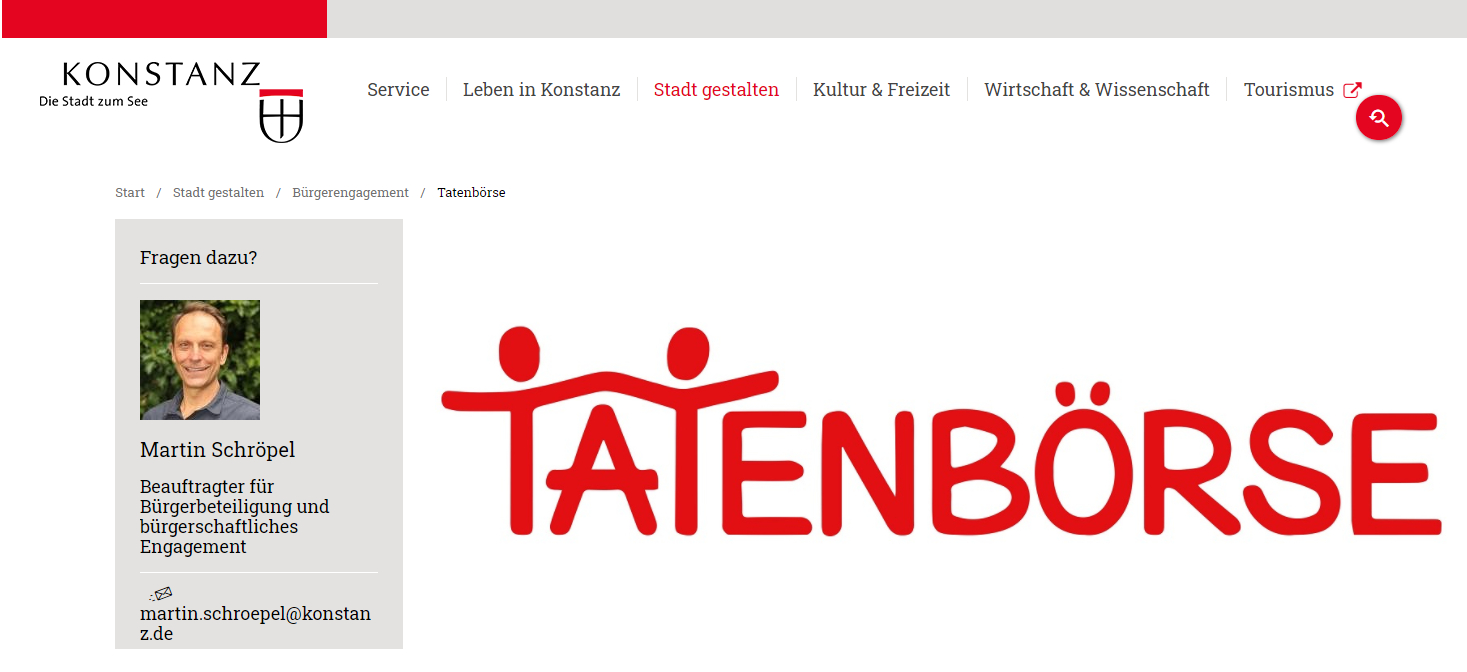
2. Anerkennung für’s Ehrenamt – Ehrensache!
1985 haben die Vereinten Nationen den „Internationalen Tag des Ehrenamtes“ beschlossen, der seit 1986 jährlich am 05. Dezember weltweit als Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements begangen wird. Dann kam Corona – und das Ehrenamt erwies sich erneut als stabiles „Rückgrat der Gesellschaft“. Aber die öffentliche Anerkennung und Würdigung des bürgerschaftlichen Engagements der rund 30 Millionen ehrenamtlich Aktiven musste am 05. Dezember 2020 in den virtuellen Raum verlegt werden.
Eine öffentliche Aufwertung erhielten alle zum Wohle der Gemeinschaft ehrenamtlich Tätigen durch den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, den der Bundespräsident anlässlich des Tags des Ehrenamts an Frauen und Männer aus allen Bundesländern für ihr „außerordentliches bürgerschaftliches Engagement“ verleiht. Dabei umfassen die zu würdigenden Verdienste ein breites Spektrum: Ausgezeichnet können Frauen und Männer werden, die sich in der „Bildungs-, Jugend- und Seniorenarbeit, im sozialen, kirchlichen und kulturellen Bereich“ usw. verdient gemacht haben.
„Ohne Ehrenamt wäre unsere Gesellschaft ärmer!“, dachten sich wohl auch die Initiatoren und Organisatoren des Bundesverbandes der Vereine und des Ehrenamtes e. V. (bvve) und organisierten - unterstützt unter anderem von der Stadt Konstanz - passend zum Tag des Ehrenamtes in einer Zeit, in der man sich nicht persönlich begegnen und austauschen kann, mit einem anspruchsvollen, aber praxisorientierten Programm den „Ersten interaktiven Bildungskongress zur Digitalisierung im Verein, Ehrenamt und Bürgerengagement“.
Vereine brauchen einen von außen wohlwollend begleiteten Digitalisierungsschub. Das sieht der Oberbürgermeister der Stadt Konstanz, Uli Buchardt, ebenso und stellt in seinem Grußwort zum Kongress fest, dass Digitalisierung die Welt rasant verändere „und das Auswirkungen hat auf jeden einzelnen Verein. Das beste Beispiel ist die Kommunikation. Wer heute im Verein eine zeitgemäße, attraktive Jugendarbeit machen will, kommt um ‚soziale Medien‘ kaum herum.“ Er fügt noch weitere Beispiele an und empfiehlt schließlich, „die einzelnen Bausteine auf dem Weg zum digitalen Verein zusammen zu denken und aufeinander abzustimmen“; denn – so das Resümee des Oberbürgermeisters – Vereine seien für die Kommunen von zentraler Bedeutung: „Sie schaffen Kultur, organisieren den Sport, bringen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Alter zusammen, integrieren, helfen und sorgen sich um unsere Umwelt. … Ich bin der Meinung, die öffentliche Hand darf unsere Vereine auf diesem Weg nicht alleine lassen. Unsere Vereine brauchen Unterstützung, um in einer digitalen Welt zukunftsfähig zu bleiben.“ In Zeiten der Pandemie erst recht: „Digitalisierung bedeutet Teilhabe auch dann, wenn reales Teilnehmen gerade nicht möglich ist“, heißt es in der Ankündigung zum Kongress.
Den bvve scheint das geradezu zu motivieren. Er organisierte – ehrenamtlich - nicht nur den Bildungskongress mit mehr als 3.000 Teilnehmenden sozusagen für „Vereine 4.0“ mit den Themen „Digitalisierung – Verein 4.0 in der Cloud“, „Rechtliches und Satzung“ „Nachfolgefindung durch Organisationsentwicklung“ und „Förderungen und Finanzierungen“, sondern hat in der Zwischenzeit weitere Workshops entwickelt wie zum Beispiel „Das digitale Vereinsheim – das Warten hat ein Ende“ im März 2021.
Das alles getreu seinem Motto, Vereine zukunftsfähig zu gestalten; denn das ist sein Ziel: spartenübergreifend Vereine in Sport, Kunst, Kultur, Freizeit und Sozialem zu fördern, zu stärken und zu entwickeln.

Vielleicht lohnt es sich, einmal auf der Website des Verbandes www.bundesverband.bvve.de vorbeizuschauen.
3. Wir müssen uns bewegen – Sport- und Bewegungsräume der Zukunft
Ungewollt hat dieses Thema aufgrund der Corona-Pandemie noch an Aktualität und Bedeutung gewonnen, heißt es doch für die kommunale Sportverwaltung, dafür zu sorgen, dass während des Lockdowns, wenn schon die Sportstätten nicht oder nur äußerst eingeschränkt genutzt werden dürfen, zumindest den Individualsport gerade für Kinder und Jugendliche, aber auch für Seniorinnen und Senioren im öffentlichen Raum zu ermöglichen. Daran konnte beim 26. Symposium zur nachhaltigen Entwicklung des Sports vom 12. bis 13. Dezember 2019 in Bodenheim/Rhein noch niemand denken. Dennoch: Nützlich kann die jetzt vorliegende Dokumentation mit ihren Ideen und Anregungen auch in der Krisensituation sein.
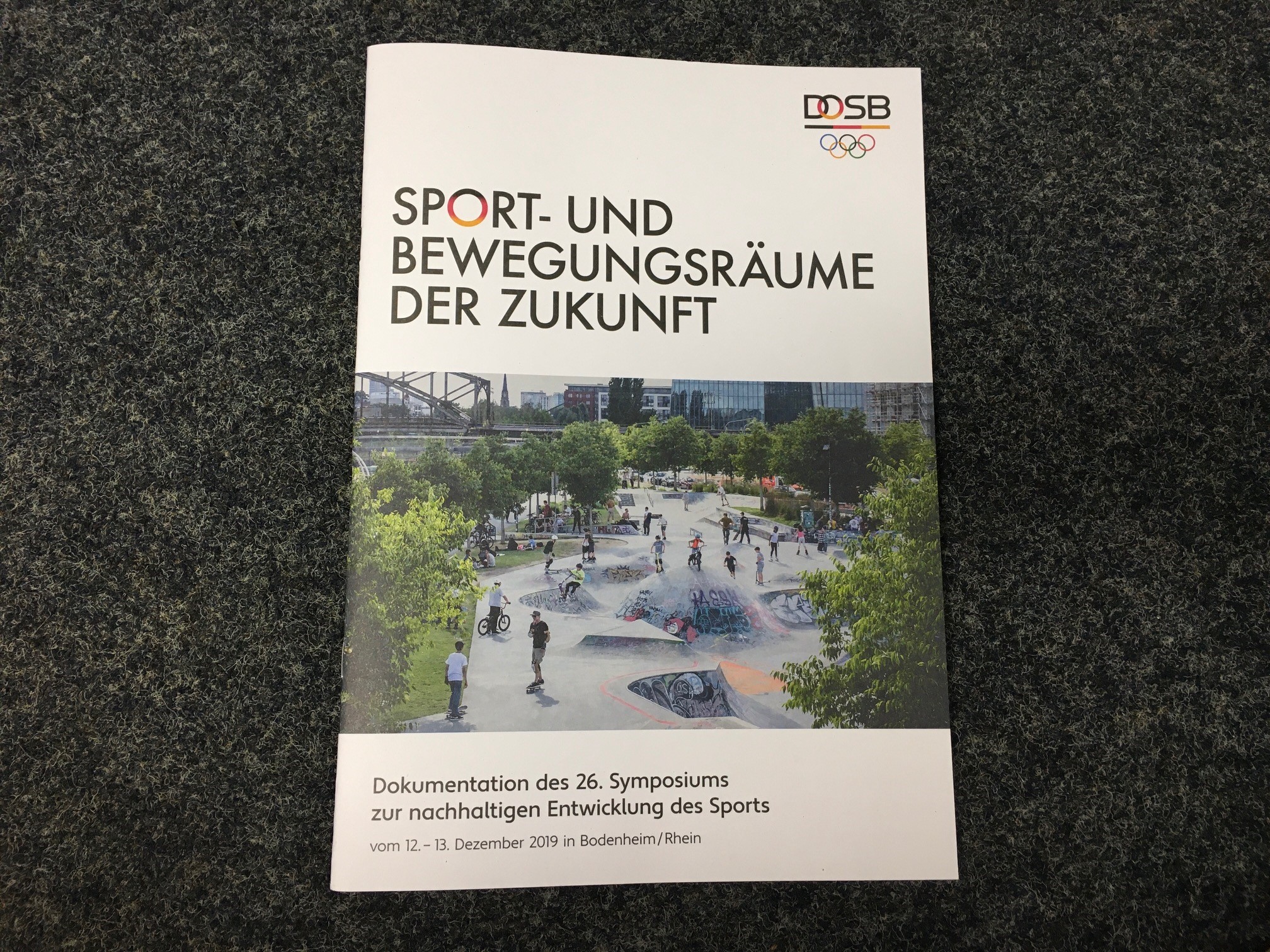 Thomas Wilken umreißt in seinem Beitrag „Sport und Bewegungsräume der Zukunft die Rahmenbedingungen: „Die demografische Entwicklung, die Ausdifferenzierung von Lebensstilen, die zunehmende kulturelle Vielfalt und die Technisierung von Arbeit und Alltag wurden und werden von ausgeprägten Veränderungen des Sportverhaltens begleitet: Heute werden nicht an Wettkämpfen orientierte sportliche Aktivitäten bevorzugt, die Mehrzahl der sportlich aktiven Menschen bewegt sich außerhalb klassischer Sportstätten und der Anteil des selbstorganisierten, nicht vereinsgebundenen Sporttreibens hat deutlich zugenommen.“ Und muss dies seit einem Jahr auch; denn Sport im Verein und auf bzw. in (meist kommunalen) Sportanlagen ist seit Beginn der Corona-Pandemie nicht oder nur eingeschränkt möglich. Damit entfallen mit dem Schulsport für Kinder und Jugendliche nicht nur Teile ihrer „Alltagspflichten“, sondern auch die für viele beliebteste Freizeitaktivität, sich zu bewegen und Sport zu treiben - mit allen sozialen und gesundheitlichen Konsequenzen. Die Älteren unter uns verlieren nicht selten ihre einzigen, zumindest aber für sie wichtigen sozialen Kontakte.
Thomas Wilken umreißt in seinem Beitrag „Sport und Bewegungsräume der Zukunft die Rahmenbedingungen: „Die demografische Entwicklung, die Ausdifferenzierung von Lebensstilen, die zunehmende kulturelle Vielfalt und die Technisierung von Arbeit und Alltag wurden und werden von ausgeprägten Veränderungen des Sportverhaltens begleitet: Heute werden nicht an Wettkämpfen orientierte sportliche Aktivitäten bevorzugt, die Mehrzahl der sportlich aktiven Menschen bewegt sich außerhalb klassischer Sportstätten und der Anteil des selbstorganisierten, nicht vereinsgebundenen Sporttreibens hat deutlich zugenommen.“ Und muss dies seit einem Jahr auch; denn Sport im Verein und auf bzw. in (meist kommunalen) Sportanlagen ist seit Beginn der Corona-Pandemie nicht oder nur eingeschränkt möglich. Damit entfallen mit dem Schulsport für Kinder und Jugendliche nicht nur Teile ihrer „Alltagspflichten“, sondern auch die für viele beliebteste Freizeitaktivität, sich zu bewegen und Sport zu treiben - mit allen sozialen und gesundheitlichen Konsequenzen. Die Älteren unter uns verlieren nicht selten ihre einzigen, zumindest aber für sie wichtigen sozialen Kontakte.
Da trifft es sich gut, dass die in der Dokumentation zusammengefassten Beiträge das Thema aus „wissenschaftlicher, planerischer, kommunaler oder verbandlicher Perspektive“ beleuchten. Die kommunale Sicht vertritt zum Beispiel die Kollegin Martina Ellerwald, Mülheimer SportService, mit dem Beitrag „Den Stadtteil bewegen – Der Sportpark Styrum“. Klaus Hebborn, Beigeordneter für Bildung, Kultur, Sport und Gleichstellung beim Deutschen Städtetag, hebt „die Bedeutung von Sport und Bewegung für die Standort- und Lebensqualität hervor“ und Bernard Kössler, Vorstand für Sportinfrastruktur beim Hamburger Sportbund, sieht im sparsamen Umgang mit Flächen und der Errichtung multifunktionaler Anlagen das Gebot der Stunde.
Auch wenn ursprünglich nicht zu diesem Zweck erarbeitet, kann vielleicht die Dokumentation in dieser herausfordernden Zeit das eine oder andere Mal eine wertvolle Anregung sein.
Die Dokumentation steht auf der Homepage des DOSB als Download zur Verfügung.
4. Klinisch sauber: Konzept zur Reinigung und Sanitation von Sporthallen
„Sauberkeit, also die erbrachte Qualität, ist etwas sehr Subjektives, jeder hat davon seine ganz eigene Vorstellung. Leider beschreibt diese banale Erkenntnis, so richtig sie sein mag, aber ein Kern-Dilemma: den ‚ermüdenden‘ Diskurs zwischen Auftraggeber und Dienstleister über die Qualitätsfrage“, ist im STADIONWELT Newsletter vom 10. März 2021 zu lesen. Dazu kommt, dass in Zeiten der Corona-Pandemie die Unsicherheit zum Beispiel darüber wächst, ob und welches Risiko einer Ansteckung in Sporthallen besteht und welche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen erforderlich sind. Dieser Thematik hat sich die RAL-Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V. angenommen und im Juli 2020 das „Konzept zur Reinigung und Sanitation von Sporthallen“ mit einer Stellungnahme von Prof. Dr. med. Prof. h.c. Walter Popp von der HyKoMed GmbH als Handlungsempfehlung für Auftraggeber und Gebäudedienstleister herausgegeben. Unter anderem untersucht das Konzept die einzelnen in einer Sporthalle vorzufindenden Raumarten und gibt Hinweise zu den zu verwendenden Reinigungsmaterialien, zu Reinigungsintervallen usw.
Das Konzept steht mit freundlicher Genehmigung der Gütegemeinschaft Gebäudereinigung hier zum Download zur Verfügung.
5. Was wir voneinander lernen können
KGSt-Betriebsdatenabfrage „Kommunales Sportstättenmanagement“
Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) führt noch bis Anfang April unter den Mitgliedsstädten ab 50.000 Einwohner*innen eine Betriebsdatenabfrage durch, um mit den wichtigsten Erkenntnissen einen anonymisierten, sogenannten Benchmarking-Bericht zu erstellen, der, wie Gregor Zajac, Referent im Geschäftsbereich Beratung & Vergleiche, erklärt, einen „allgemeinen Überblick über Strukturen, Organisationen und Fachfragen zum kommunalen Sport- und Bewegungsmanagement in Berichtsform zusammenfassen wird.“ Das hört sich interessant an, und so entstand die Idee, nach Fertigstellung des Berichts den Teilnehmer*innen einer der nächsten Jahrestagungen im Einzelnen vorzustellen, Praxisbeispiele aus Städten kennenzulernen und Trends und Entwicklungen zu erfassen und zu analysieren.

Für die ADS wäre es für einen konkreten Informations- und Erfahrungsaustausch bestimmt hilfreich, wenn sich vorher auch viele der in Frage kommenden ADS-Mitgliedsstädte an der Betriebsdatenabfrage noch beteiligen würden, auch wenn sich Zajac über 60 ausgefüllte Fragebögen und über Anfragen in etwa gleicher Höhe freut. Aber, weiß der erfahrene Referent, eine noch größere Beteiligung macht „die Datenbasis immer aussagekräftiger“ – auch für die ADS. Bis Anfang April könnten der KGSt deshalb noch weitere Ergebnisse zugesandt werden. Danach sei eine Auswertung vorgesehen, die dann in eine zweitägige Sitzung des bereits seit acht Jahren bestehenden Vergleichsrings, die im November in Kassel stattfinden soll, münden solle. Hier könnten dann die Ergebnisse der Abfrage diskutiert und plausibilisiert sowie interessante Beispiele von Städten vorgestellt werden.

Der Betriebsabfragebogen kann bei der KGSt unter der E-Mail-Adresse Gregor.Zajac@kgst.de angefordert und Fragen rund um die Datenabfrage können per E-Mail oder telefonisch unter der Nummer 0221 / 37689953 gestellt werden.
6. „Wir müssen digitaler werden …“
Das Weiterbildungsprogramm 2021 der Führungsakademie
Es dürfte sich auch für die Kolleginnen und Kollegen der kommunalen Sportverwaltungen lohnen, einmal im diesjährigen Weiterbildungsprogramm zu blättern, dessen Inhaltsverzeichnis in einer „bunten Mischung an Themen und Formaten“ über 30 Seminare umfasst. Das Programm mit Präsenz- und Online- Angeboten ist ausschließlich auf der Website der Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) www.fuehrungs-akademie.de veröffentlicht worden.
„Wir müssen digitaler werden …“ überschrieb die Führungs-Akademie den 4. „Boxenstopp“ am 17. Februar 2021 und knüpfte damit an die besonderen Erfahrungen der Corona-Zeit, die auch an den Sportvereinen nicht spurlos vorbeigegangen sind, an – eine Feststellung, die sich auch die Vorstandsvorsitzende des Trägerverein, Veronika Rücker, und der Direktor, Florian Scheibe, bei der Gestaltung des Weiterbildungsprogramms 2021 zu eigen gemacht hatten: „Neben allen Einschränkungen, die wir erfahren, haben uns die Herausforderungen auch angeregt, kreativ zu werden, gewohnte Prozesse zu überdenken, innovative Angebote zu entwickeln und Veränderung voranzutreiben“, schreiben sie im Vorwort. Über 30, teils aus mehreren Modulen bestehende Angebote aus den Kompetenzfeldern Fach-, Management- und Führungskompetenz sowie eine Webinar-Reihe zum Thema „Rechtsfragen zum Vereins- und Verbandsrecht“ bietet das Programm an. Dabei reicht die Palette von Datenschutz und Sponsoring über Vergaberecht, Öffentlichkeitsarbeit, Risiko- und Krisenmanagement bis hin zur „Digitale Kommunikation gestalten und optimieren“ und „Digitale Transformation im organisierten Sport.“
Hier können Sie das Weiterbildungsprogramm herunterladen.
7. Wir stellen vor: Stadt Konstanz – Amt für Bildung und Sport
Das Amt für Bildung und Sport in Zahlen
Lage: Vierländereck in Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Direkt am Bodensee
Einwohnerinnen und Einwohner: 85.837 (Stand: 31.12.2020)
Amtsbezeichnung: Amt für Bildung und Sport
Anzahl der Mitarbeiter*innen: Insgesamt: 7,5 (3,5 MA Verwaltung / 4 MA Betrieb Sportstätten)
Anzahl der Außensportanlagen: insgesamt:17 davon
- 7 Kunstrasenplätze, davon städtische Trägerschaft: 7
- 10 Rasenfelder, davon städtische Trägerschaft: 4
- 3 Leichtathletikanlagen, u.a. Typ-A-Anlage im Bodenseestadion
Anzahl der Sporthallen: 25 insgesamt; davon 17 Schulturnhallen
Anzahl der Schwimmbäder und -hallen: 9 Bäder insgesamt
davon 2 Hallenbäder, 6 Strand-/Freibäder und 1 Thermalbad, Trägerschaft: Bädergesellschaft Konstanz mbH
Anzahl der Sportvereine und Mitgliedschaften: 101 Vereine mit 24.922 Mitgliedern, davon ca.31,52 % Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)

1. Wo ist die Sportverwaltung innerhalb der Verwaltung angesiedelt und wie ist sie aufgebaut? Was sind die Hauptaufgaben?
Das Amt für Bildung und Sport mit der Abteilung Sport ist bei der Stadt Konstanz im Dezernat II – Soziales, Bildung, Sport, Gesundheit und Kultur unter Herrn Bürgermeister Dr. Andreas Osner angesiedelt. In der jetzigen Form als Zusammenschluss der Bereiche Bildung/Schule und dem Bereich Sport existiert das Amt seit 2018 unter der Leitung von Frank Schädler. Die Abteilungsleitung Sport trägt Patrick Glatt mit insgesamt 2,5 Mitarbeitenden und zwei dualen Studenten. Hinzu kommen 28 Hallen- und Platzwarte auf den Sportanlagen.
Als Hauptaufgabe verwaltet die Abteilung Sport die 24 städtischen Sporthallen und insgesamt 19 städtische Rasen- und Kunstrasenplätze. Von der Unterhaltung bis zur finalen Belegung und Abrechnungen laufen diese Aufgaben im Amt für Bildung und Sport zusammen. Hinzu kommen die Umsetzung und ständige Evaluierung der städtischen Sportförderung mit einem jährlichen Volumen von knapp 1,4 Mio. €. Weitere Aufgaben sind die Umsetzung und Fortführung der Sportentwicklungsplanung, der Unterstützung von Veranstaltungen durch die Konstanzer Sportvereine bzw. die Organisation der jährlichen Sportlerehrungen.
2. Was sind die aktuellen Höhe-/Schwerpunkte der Arbeit?
Der Konstanzer Sport ist, wie in ganz Deutschland, durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie schwer mitgenommen. Dies hat die Aufgabenschwerpunkte auch in der Sportverwaltung stark verändert. Durch die mehrmonatige Schließung der Sporthallen und Freisportanlagen stehen viele Vereine teilweise vor existenziellen Problemen. Wir verzeichnen einen Mitgliederrückgang im Verhältnis zum Jahr 2020 von knapp 1.000 Mitgliedern in den Vereinen.
Das Amt für Bildung und Sport berät und unterstützt die Vereine hierbei in der Abschöpfung von möglichen Förderprogrammen und in der Umsetzung der Regelungen durch die jeweilige Corona-Verordnung. Gemeinsam mit dem Stadtsportverband, der Interessensvertretung der Konstanzer Sportvereine, wird derzeit an einem städtischen Rettungsschirm für die Sportvereine gearbeitet.
Als größtes Bauprojekt steht im zweiten Halbjahr/ Quartal 2021 der Erweiterungsbau der Schänzlehalle, der Heimspielstätte der HSG Konstanz - der höchstklassige Konstanzer Sportverein -, um ein weiteres Hallendrittel auf zwei Etagen an. Gleichzeitig laufen die Planungen für den Neubau einer höchstnotwendigen weiteren Dreifachsporthalle. Durch die geografische Lage am Bodensee, welcher eine natürliche Begrenzung bildet und der direkten Grenze zur Schweiz ist die Flächenproblematik in Konstanz hochbrisant. Hierbei profitiert das Amt für Bildung und Sport von der Zusammenlegung, besonders weil die Interessen von Schule und Sport durch ein gemeinsames Sprachrohr an die Politik gebracht werden können.
Das Thema Mountainbiken in den Wäldern rund um Konstanz erfährt seit gut einem Jahr verstärkte Aufmerksamkeit. Dabei gilt es, nicht nur den Mountainbikern einen Raum zur Ausübung Ihres Sportes zu bieten, sondern auch eventuelle Nutzungsproblematiken präventiv anzugehen. Mit einfachen Maßnahmen sollen spezielle Bereiche für das Mountainbiken ausgewiesen und die Nutzung so kanalisiert werden. Im nächsten Schritt ist eine Ausweitung von Mountainbike-Strecken auf die angrenzenden Gemeinden bzw. den Landkreis angedacht.
3. Was sind die (sportbezogenen) Ziele der Stadt Konstanz (allgemeine strategische Ziele) und was sind die Ziele der Sportentwicklungsplanung?
Die Stadt Konstanz will den städtischen Sportvereinen die bestmögliche Sportförderung bieten. Die Sportförderrichtlinien stammen aus dem Jahr 2002, wobei es im vierjährigen Turnus eine Überarbeitung der Richtlinien gibt. Für das Jahr 2022 ist eine weitere Überarbeitung vorgesehen.
Seit dem Jahr 2016 wurde die Sportförderung um eine spezielle Jugendsportleistungsprämie erweitert, welche den Vereinen die Möglichkeit bietet, für Kinder- und Jugendliche im Wettkampfbetrieb einen zusätzlichen Zuschuss zu erhalten. Die Erweiterte Jugendförderung beläuft sich auf ca. 180.000 € pro Jahr. Für das Jahr 2022 ist eine weitere Erweiterung angedacht, welche auch Jugendleistungsmannschaften in den höchsten deutschen Ligen Fördermöglichkeiten bietet. Die Förderung soll sich im Bereich von ca. 150.000 € pro Jahr liegen.
Gemeinsam mit der Universität Konstanz wird derzeit die Einbindung des gesellschaftlichen Wertes als Kriterium für die Sportförderung geprüft. Das heißt, kann die Förderung von Sportvereinen an ihr gesellschaftliches Wirken gekoppelt werden. Können Vereine, welche beispielsweise besonders viele Schul- oder Kita-Kooperationen durchführen, auch mehr Sportfördermittel erhalten, als Vereine, welche dies nicht tun? Die ersten Ergebnisse sind für das Frühjahr 2022 zu erwarten.
Des Weiteren hat sich Konstanz ein - der geografischen Lage der Stadt am Bodensee geschuldetes - sportliches Hauptziel gesetzt: Alle Kinder sollen spätestens nach der vierten Schulklasse schwimmen können. Schwimmen zu können ist in Konstanz ein lebensnotwendiges Gut und steht daher an erster Stelle. Gemeinsam mit DLRG und den Schwimmsportvereinen laufen die Planungen für die Unterstützungsprogramme der städtischen Grundschulen. Start des Programmes ist allerdings erst ab Frühjahr 2022, bedingt durch den tragischen Verlust des örtlichen Schwimmbades durch ein Feuer im Jahr 2015. Mit der Wiedereröffnung im Frühjahr 2022 wird das ehrgeizige Ziel vorangetrieben.
Das Amt für Bildung und Sport hat in Eigenregie im Jahr 2020 die städtische Sportentwicklungsplanung fortgeschrieben, welche zuletzt im Jahr 2012 durch die Universität Konstanz entwickelt wurde. Der „Sportbericht 2020“ umfasst sowohl die weitere Priorisierung des Ausbaus der Sportanlagen, wie auch die Bedarfsermittlung der Konstanzer Schulen hinsichtlich des Sportunterrichtes. Der Sportbericht dient somit der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Konstanzer Sportinfrastruktur.
Für das Jahr 2022 ist eine neue Sportverhaltensstudie geplant, welche insbesondere den informellen Sport abdecken soll. Zwar wurden in den letzten Jahren viele öffentliche Sportanlagen umgesetzt, jedoch ist die Nachfrage weiterhin sehr hoch. Besonders bei der Quartiersentwicklung sollten öffentliche Sport- und Bewegungsflächen stets vorgesehen werden. Bei der Konzipierung sollten die unterschiedlichen Nutzergruppen klar definiert und berücksichtigt werden.
4. Ein Schwerpunktthema ist in vielen (Sport-)Verwaltungen die Digitalisierung. Wie ist das Amt für Bildung und Sport der Stadt Konstanz aufgestellt?
Das Amt für Bildung und Sport hat sich als erstes Amt der Stadt Konstanz für das papierarme Büro ausgesprochen und die Umsetzung konsequent vollzogen. Alle Akten und Materialien wurden digitalisiert und stehen per DMS-System wieder zur Verfügung. Gleichzeitig wurde mobiles Arbeiten durch die Anschaffung von mobilen Endgeräten bereits 2019 vollzogen. Somit ist es dem Amt für Bildung und Sport auch in der derzeitigen pandemischen Lage möglich, komplett aus dem Home-Office zu arbeiten.
Ein wichtiger Schritt ist die Digitalisierung der Arbeitsabläufe besonders auf den großen Sportanlagen. Neben App-Steuerungen für die Bewässerungs- und Lichtschaltautomatiken wurden sukzessiv alle Sporthallen mit elektronischen Schließanlagen ausgestattet, so dass eine bessere Besuchersteuerung und -kontrolle erfolgen kann.
Bei der Belegungsverwaltung der Sportstätten setzt das Amt für Bildung und Sport auf die bekannte Software Skubis.
5. Die Corona-Pandemie hat auch die Aufgaben der Sportverwaltung verändert. Wie hat das Amt für Bildung und Sport den Sport und die Sportverwaltung durch die Krise gesteuert?
Die Herausforderung durch die Corona-Pandemie haben sicherlich die Arbeitstätigkeiten aller stark verändert. „Krisenmanagement at it´s best“. Besonders mit den ersten Lockerungen für den Sport im Mai 2020 war das Erklären und die möglichen Umsetzungen der Corona-Verordnung tägliches Geschäft. Neben dem Sport-Newsletter, welcher in regelmäßigen Abständen erscheint, wurde in unzähligen täglichen Telefon- bzw. Videokonferenzen den Vereinen Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese unter den Vorgaben der Verordnung ihren Trainingsbetrieb wieder starten konnten. Dies führte zu skurrilen Szenen wie beispielsweise mit 35 Karatekas in einer Sportanlage mit über 10.000 qm. Gemeinsam mit dem Stadtsportverband wurden Vorlagen für Hygienekonzepte erstellt, sowohl für den Trainingsbetrieb, wie später für die Rückkehr zum Wettkampfsport. Besonders arbeitsintensive Tage waren sicherlich vor bzw. nach der Verkündigung der neuen Verordnungen. Aber es muss auch gesagt werden, dass sich der Sport äußerst vorbildlich verhalten hat.
Mit dem zweiten Lockdown im November, welcher derzeit noch bis Mitte Februar anhält, haben sich die Thematiken stark verschoben. Allerdings gehen wir leider davon aus, dass der Sportbetrieb für den Freizeit- und Amateurbereich auch nach dem 14.02.2021 weiter ruhen wird. Die Vereine haben sich an Hygienekonzepte und Regelungen gewöhnt, jedoch kämpfen die Vereine zusehend um ihre Existenz. Besonders Vereine mit eigener Sportinfrastruktur kommen an ihre Grenzen. Durch Pachtausfälle, fehlende Mitgliedsbeiträge bzw. Mitgliederschwund und laufenden Kosten, welche nicht minimiert werden können, stehen viele Vereine vor einem Scherbenhaufen. Ein Rettungsschirm für Vereine in Schieflage ist derzeitig in Planung, die Umsetzung jedoch durch die ebenfalls schwierige Haushaltslage der Stadt Konstanz im Jahr 2021 ungewiss.
Derzeit unterstützt die Sportverwaltung gemeinsam mit dem Beauftragten für Bürgerbeteiligung und Bürgerschaftlichem Engagement die Vereine auch in der Umsetzung von digitalen Jahreshauptversammlungen. Die Stadt hat hierfür Lizenzen für Videotools und Meeting-Programmen gekauft und stellt diese kostenfrei den Konstanzer Vereinen zur Verfügung. Alles natürlich unter der Obhut der DSGVO und unter technischem Support durch Mitarbeit der Verwaltung.
Wir sehen die ADS-Mitgliedschaft als einen Gewinn, weil ...
… der kollegiale Austausch von immenser Bedeutung ist. Durch die ADS werden Informationen in hervorragender Weise aufgearbeitet, Themen vorgestellt, fokussiert und weiterentwickelt. Besonders die Jahrestagung ist ein jährlich wichtiger Ideengeber. Gleichzeitig erhalten die Sportverwaltungen durch die ADS ein Sprachrohr auf Bundesebene. Danke für diese sehr wichtige Arbeit!

Frank Schädler - Amtsleitung Amt für Bildung und Sport // Patrick Glatt - Leitung Abteilung Sport
Bilder Konstanz: ©Chris Danneffel und ©MTK Dagmar Schwelle